Karl Barth und Walter Benjamin im Gespräch
Der Erste Weltkrieg veranlasste sowohl Karl Barth als auch Walter Benjamin, sich kritisch mit dem Begriff der Geschichte auseinanderzusetzen. So entstanden innerhalb von zwei Jahrzehnten herausragende Positionen, die das überkommene Geschichtsverständnis grundlegend transformierten. Andreas Frei vergleicht in seiner Studie beide Geschichtsauffassungen miteinander und erschliesst sie ausgehend von Hegels Geschichtsphilosophie und dem nachfolgenden Historismus. Dabei zeigen sich sowohl überraschende Verbindungen als auch markante Differenzen. Auch heute noch stellt sich die grundsätzliche Frage, was Geschichte für die Gegenwart bedeutet. Es zeigt sich eindrücklich, wie aktuell die Geschichtsdeutungen von Barth und Benjamin noch immer sind – und wie Bilder der Geschichte entstehen, insbesondere im Angesicht der Krise.
Andreas Frei ist 1990 geboren. Er ist Assistent und Doktorand am Institut für Systematische Theologie / Abteilung Dogmatik und Religionsphilosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Bern.
„Aber an was für steile, grifflose Wände rücken wir da nun näher und immer näher heran…“
An diese Worte, die Eduard Thurneysen an Karl Barth am 7. Dezember 1922 schrieb, fühlte ich mich erinnert bei der Lektüre des so spannenden wie faszinierenden Buches von Andreas Frei. Frei macht dort den Versuch, zwei so heterogene Denker wie Karl Barth und Walter Benjamin, die sich mit grosser Wahrscheinlichkeit persönlich nie begegnet sind und sich in ihrem Denken gegenseitig - wenn überhaupt - nur marginal wahrgenommen haben, miteinander ins Gespräch zu bringen, oder besser gesagt: ineinander zu lesen.
Das Buch versetzt uns in die Debattenlandschaft des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts. Und ich möchte meine Besprechung des Buches in der Form vornehmen, dass ich eine Erkundungsreise in diese Landschaft versuche. Die Jahre 1918 bis 1933 (das umreisst gerade die kurze Lebensdauer der Weimarer Republik) gehören - nicht nur dort, aber insbesondere dort - in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich zu den kulturell spannendsten Jahrzehnten. Die ökonomisch-technische Entwicklung der letzten hundert Jahre hat den ganzen Kontinent gleichsam umgepflügt, und dies spiegelt sich auch in der kulturellen Landschaft wieder: In der Bildenden Kunst stellt der Kubismus die über Jahrhunderte geltende Zentralperspektive in Frage; die Zwölf-Ton-Musik erschüttert die vertrauten Harmonien; auf dem Monte Verita wird ein ganz neues Verhältnis zum eigenen Körper erprobt; eine Annemarie Schwarzenbach bewegt sich als selbstständig und selbstbewusst Frau in der literarischen Welt der Schweiz - um nur einige wenige Beispiele zu nennen.
Die intellektuellen Diskurse, die diese fundamentalen Veränderungen begleiten, gehören für mich zum Spannendsten der neueren europäischen Geistesgeschichte: Eine in ihren Grundfesten erschütterte Moderne versucht, sich neu aufzustellen. In diesen Kontext gehört auch das Denken des frühen Karl Barth und Walter Benjamin.
Um jedoch dieses intellektuelle Geschehen zu begreifen, müssen wir in der Denklandschaft 100 Jahre zurück gehen. Im Grunde beginnt alles mit Hegel. In seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“ findet sich der wuchtige Satz: „Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, – ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben.“ Mag der nachfolgende Historismus dies auch differenziert und gebrochen haben, so läuft auch für die grossen preussischen Historiker dieser Zeit letztlich alles auf „Preussen“ hinaus. Und auch die Theologie hat sich diesem Fortschrittsdenken gleichsam angeschmiegt. Als Höhepunkt dieser Entwicklung kann der berühmte Vorlesungszyklus von Adolf von Harnack über „Das Wesen des Christentums“ gelten. Harnack setzt diese Vorlesung mit Bedacht im Wintersemester 1899/1900 an. Sie soll das Resümee des theologischen Denkens des zu Ende gehenden Jahrhunderts sein und zugleich den Weg für das Christentum in das 20. Jahrhundert vorzeichnen. Diese Vorlesung endet mit den Worten: „Wenn wir aber mit festem Willen die Kräfte und Werte bejahen, die auf den Höhepunkten unseres inneren Lebens als unser höchstes Gut, ja als unser eigentliches Selbst aufstrahlen, wenn wir den Ernst und den Mut haben, sie als das Wirkliche gelten zu lassen und nach ihnen das Leben einzurichten, und wenn wir dann auf den Gang der Geschichte der Menschheit blicken, ihre aufwärts sich bewegende Entwicklung verfolgen und strebend und dienend die Gemeinschaft der Geister in ihr aufsuchen – so werden wir nicht in Überdruss und Kleinmut versinken, sondern wir werden Gottes gewiss werden, des Gottes, den Jesus Christus seinen Vater genannt hat, und der auch unser Vater ist.“
Gegen diesen historischen wie theologisch-lebensgeschichtlichen Optimismus wenden sich nun ein Karl Barth und ein Walter Benjamin gleichermassen. Andreas Frei zeichnet dies in seinem Buch auf eindrückliche Weise nach: Karl Barth in seinem ausgreifenden Römerbriefkommentar (S. 99-141) und Walter Benjamin in seinen kurzen, fragmentarisch anmutenden „Thesen über den Begriff der Geschichte“ (S. 149-201). Dabei steht Barth in den Anfängen dieses intellektuellen Diskurse, während Benjamin im Jahre 1940 bereits im Angesicht der nächsten Katastrophe auf das Scheitern dieses Diskurses zurückblickt.
Barth hatte im Jahre 1914 ein doppeltes Erschrecken: Zum einen darüber, dass die deutsche Sozialdemokratie so widerstandslos in das Lager der Kriegsbefürworter wechselte. Und zum Anderen darüber, dass viele seiner theologischen Lehrer in dem berühmt-berüchtigten Manifest der 93 „An die Kulturwelt“ den aggressiven Kurs des Deutschen Reiches unter Wilhelm II legitimierten. Mag in der Rückschau Barth selbst sein Entsetzen noch etwas überhöht haben, so zeigen schriftliche Zeugnisse aus den Jahren 1914/15 - vor allem der Briefwechsel mit Eduard Thurneysen -, dass dies keine nachträgliche Erfindung war, sondern dass es für Barth in der Tat so war, wie er es im Jahre 1968 aus der Rückschau beschrieb: „Eine ganze Welt von theologischer Exegese, Ethik, Dogmatik und Predigt, die ich bis dahin für grundsätzlich glaubwürdig gehalten hatte, kam damit und mit dem, was man damals von den deutschen Theologen sonst zu lesen bekam, bis auf die Grundlagen ins Schwanken.“
Wie heraus aus diesem Schlamassel? Die Antwort waren die beiden Auflagen der Römerbriefkommentare aus den Jahren 1918-1922. Andreas Frei zeigt nun in einem der beiden Hauptkapitel seines Buches, dass dabei die Auseinandersetzung mit dem Geschichtsbegriff eine entscheidende Rolle spielt. Offensichtlich hatte Barth ein sicheres Gespür dafür, dass die von Hegel ausgehende Traditionslinie (mit) in den Abgrund des Jahres 1914 führte. Aber Barth schreibt nun nicht - wie eine etwas simple Barthinterpretation uns nahezulegen versuchte - einfach drauf los, und sei es gegen den Strich. Sondern er greift auf Theorieelemente zurück, die auch die weiteren Diskurse der Jahre nach 1918 bestimmen, darunter der Neukantianismus, Anleihen bei Friedrich Nietzsche und insbesondere Franz Overbeck. Von Overbeck übernimmt Barth den Begriff der „Urgeschichte“, den er dem Geschichtsverständnis des „preussischen“ Historismus entgegenstellt. Die Befreiung aus den Abgründen der „menschlichen“ Geschichte ist eines der grossen Themen der beiden Auflagen der Römerbriefkommentare. Allein Gottes „Urgeschichte“ befreit dazu, aus der menschlichen Unheilsgeschichte herauszutreten. Von einem „Panthersprung“ wird später Walter Benjamin in ähnlichem Zusammenhang sprechen.
Dass „Geschichte“ ein so zentrales Thema der beiden Römerbriefkommentare ist, macht es erst sinnvoll, Barths Denken an dieser Stelle in Beziehung zu Walter Benjamins Nachdenken über Geschichte zu setzen, insbesondere in seinen berühmten Thesen „Über den Begriff der Geschichte“. Dabei steht Benjamin 1940 an einem ganz anderen Ort als Barth im Jahre 1918. Wie für Barth durch das Manifest der 93 eine theologische Welt zusammenbrach, so brach für Benjamin durch den Hitler-Stalin-Pakt des Jahres 1939 die marxistische Welt zusammen, die ihrerseits dem Hegel‘schen Fortschrittsdenken verpflichtet war. Benjamin spürte, dass dieser Pakt die Tür aufstiess zu einem Zivilisationsbruch, der die Schrecken des Ersten Weltkrieges weit übertreffen sollte.
Benjamin entwickelt nun in seinen Thesen einen Begriff der Geschichte, der auf der einen Seite das Interesse Barths teilt, perspektivisch aber geradezu einen entgegengesetzten Weg einschlägt. Sucht Barth einen Weg aus der menschlichen(Unheils-)Geschichte heraus, so setzt Benjamin an zu einem „Panthersprung“ in die Geschichte hinein. Allerdings zielt dieser Sprung auf einen genau bestimmten Platz in der Geschichte. War der bisherige Blick auf Geschichte bestimmt vom Blick auf und der - wie es oft bei Benjamin heisst - Einfühlung in die siegreichen und erfolgreichen Akteure in der Geschichte, so möchte Benjamin seinen Blick richten auf die vergessenen Opfer der Geschichte. Das „Erinnern“ oder - wie Benjamin gerne sagt - das „Eingedenken“ ist der Weg zu diesen vergessenen Opfer. Hier meldet sich unübersehbar ein biblisch-theologischer Glutkern des Geschichtsbegriffs von Benjamin an. Benjamin kann so weit gehen, dass er sagt: Geschichte sei „nicht allein eine Wissenschaft, sondern nicht minder eine Form des Eingedenkens… Was die ‚Wissenschaft‘ festgestellt hat, kann das Eingedenken modifizieren. Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene (das Glück) zu einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossene (das Leid) zu einem Unabgeschlossenen machen.“ (Zitiert S. 184) Womit er sich prompt von Max Horkheimer den Vorwurf einhandelt, dass sei nun denn doch ein Zuviel an Theologie.
Andreas Frei stellt explizit fest, dass es schwierig sei, von einem direkten Gespräch zwischen Barth und Benjamin zu sprechen, da dieses direkte Gespräch in der Tat nie stattgefunden hat. Ihr Interesse am Thema der Geschichte vereine sie jedoch in einem inhaltlichen Dialog, in dem sie bei gemeinsamen Interesse höchst verschiedene Akzente setzten. Deshalb werden auch die geistesgeschichtlichen Traditionen wichtig, die beide miteinander verbinden. In kleinen eingestreuten Miniaturen zeichnet Frei diese geteilten Traditionen nach, so etwa den apokalyptischen Messianismus und den Neukantianismus. Besonders berührt hat mich das liebevolle kleine Porträt von Fritz Lieb, der sowohl mit Barth wie mit Benjamin persönlich verbunden war (S. 143-147).
Aus der Darstellung Freis wird immer wieder deutlich, dass sowohl Barth wie Benjamin nicht allein durch die von ihnen vertretenen Inhalte gewirkt haben, sondern auch die Art und Weise, wie sie diese Inhaltlich sprachlich-ästhetisch präsentiert haben. Und es in der Tat so, dass es vor allem auch die Sprache der Römerbriefkommentare war, die die theologischen Zeitgenoss*innen Barths elektrisiert hat. Und von Benjamins „dichterischem Denken“ (Hannah Arendt) geht bis auf den heutigen Tag eine starke ästhetische Anmutung aus. Deshalb verwundert es mich auch (und das ist einer der ganz wenigen Kritikpunkte, die ich habe), dass Frei das in meinem Augen sehr wichtige Buch von Georg Pfleiderer „Karl Barths praktische Theologie“ nicht berücksichtigt hat. Pfleiderer zeichnet wie Frei Barths Denken in den Kontext der intellektuellen Diskurse der Weimarer Republik ein, aber er zielt mehr als Frei auf die performative Form dieses Diskurses ein. Dieser Diskurs hat nicht nur Inhalte benannt, sondern es werden zugleich immer auch - wie Pfleiderer das nennt - „die starken Agenten der Moderne“ benannt, gleichsam erschaffen. Oder anders gesagt: Die Art und Weise, wie argumentiert wird, konstruiert immer zugleich auch die Legitimität und Illegitimität der an diesen Diskursen Beteiligten. Barth - und dasselbe kann für Benjamin gelten - geraten so ganz eng an die Seite von so heterogenen Personen und Positionen wie Georg Lukács, Carl Schmitt, Immanuel Hirsch und Friedrich Gogarten. Andreas Frei hätte sein inhaltliches Interesse an Barth und Benjamin sicher noch konturenreicher zeichnen können, wenn er diese performative Perspektive Pfleiderers aufgegriffen hätte.
Was bleibt aus diesem merkwürdigen Nicht-(Gespräch) zwischen Benjamin und Barth? Andreas Frei wagt am Ende selbst einen Ausblick: Er zieht die Linien aus bis hin zu zu Francis Fukuayama‘s These vom „Ende der Geschichte“ und der Ästhetisierung der Geschichte durch Jean-François Lyotard in die „grossen Erzählungen“ hinein. Allein, ich habe den Eindruck, dass wir Heutigen die Posthistoire und die Postmoderne bereits wieder hinter uns gelassen haben, wahrscheinlich hinter uns lassen mussten. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Blick auf die vielen zivilen Opfer im militärischen Vorgehen Israels als Antwort auf das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 sind wir heute wahrscheinlich dem Erschrecken Barths und Benjamins näher, als wir dies ahnen und wollen können.
Andreas Frei, Bilder der Geschichte im Angesicht der Krise, Zürich 2023
Albrecht Grözinger ist evangelischer Pfarrer und Professor für Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Basel.

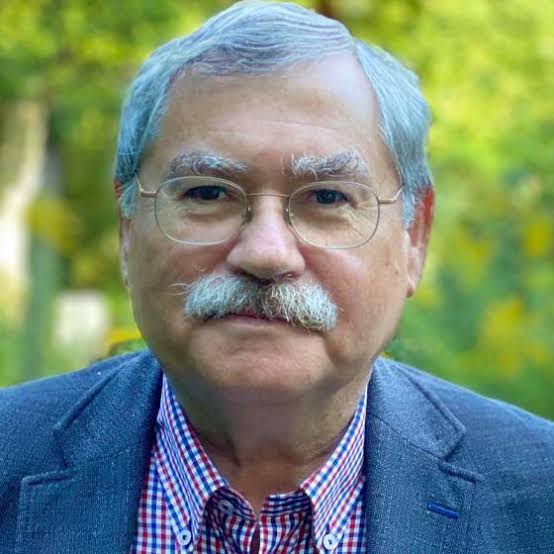
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Max Mustermann Tweet
Mehrsprachiges WordPress mit WPML